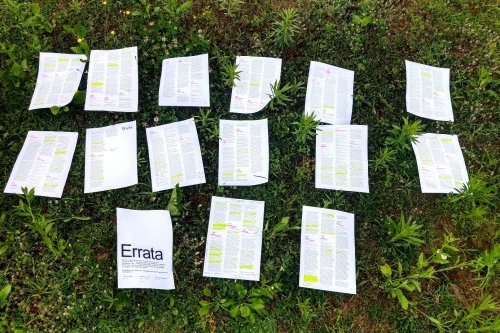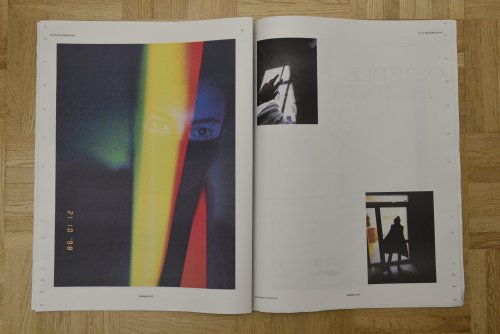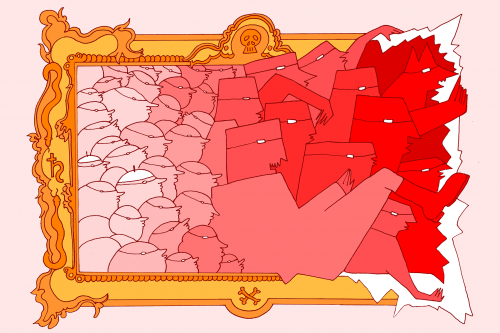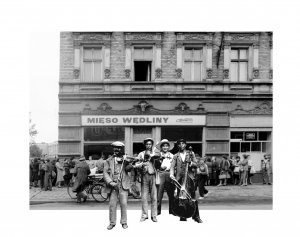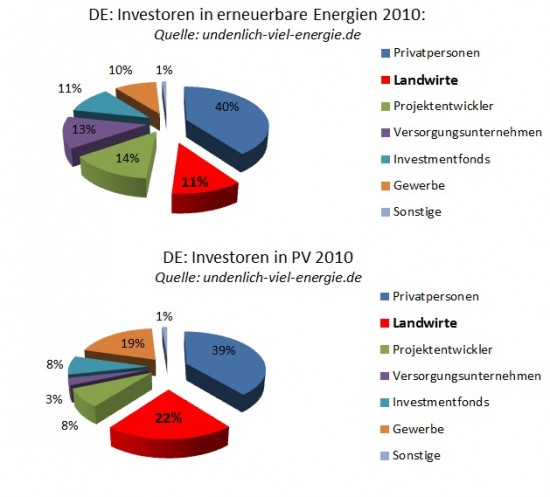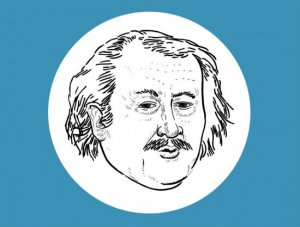„Das PiS-Schlagwort von der Demokratisierung der polnischen Gerichte ist griffig und zugleich irreführend. Kein Gericht ist jemals demokratisch. Gerichte sollen weise und gerecht sein“, argumentiert Ewa Łętowska, Professorin der Rechtswissenschaften, erste Bürgerrechtsbeauftragte Polens (1988–1992), ehemalige Richterin am Oberverwaltungsgericht und am Verfassungsgericht. Łętowska spricht über die rechtlichen Aspekte der polnischen PiS-Regierung. Sie wirft der Partei vor, die jungen und damit erst wenig etablierten polnischen rechtsstaatlichen Institutionen zu zerstören, sich einer populistischen Rhetorik zu bedienen und die Grundfesten der liberalen Demokratie zu untergraben.
Łukasz Pawłowski: Wie lassen sich die von der PiS eingeführten Änderungen im Rechtssystem beschreiben?
Ewa Łętowska: Eines der charakteristischen Merkmale des Prozesses, in dem wir seit über einem Jahr stecken – die Auslöschung des Rechtsstaats –, ist die Aufgabe der offenen Gesellschaft und damit der Verfassungsgrundlage. Die Verfassung enthält an vielen Stellen die Begriffe „einzelne Person“, „jeder“, „niemand“. Das ist eine äußerst charakteristische Bezugnahme auf eine offene Gesellschaft, die nicht nach dem Status eines Menschen unterscheidet – ob er Staatsbürger ist oder nicht.
Eine offene Gesellschaft ist per definitionem inklusiv. Sie wählt absichtlich einen großen „gemeinsamen Nenner“, damit alle „Verschiedenen“ Platz finden. Die Verfassung mit all ihren Freiheiten und Rechten ist für alle Menschen gedacht. Doch die ganze Idee des derzeitigen Establishments, also der Regierungspartei, besteht darin, die Gesellschaft zu spalten. Eine kleinere, geschlossenere, ethnisch einheitliche Gruppe zu schaffen. Wirft man die „faulen Äpfel“ weg, behält man nur die besten. Und der Rest? Soll sich der Mehrheit anpassen. Für die Verworfenen, die Ausgesonderten gilt nicht dasselbe wie für die wahren Polen.[1]
Das ist eine grundlegende Eigenschaft populistischer Parteien wie der PiS: Sie stellen dem „wahren“ Volk dekadente „Eliten“ und fremdbestimmte „Agenten“ gegenüber. Darüber, wer zu welcher Gruppe gehört, entscheiden natürlich die Parteiführer. Zeigt diese Rhetorik schon konkrete Konsequenzen?
Natürlich. Wenn in der Verfassung ein Rechtssystem eingeschrieben ist, das verschiedenste Menschen mit einschließen soll, dann ergeben sich daraus bestimmte Richtlinien, wie dieses System zu konstruieren ist und wie zum Beispiel Minderheitenrechte garantiert werden können. Die derzeitige Regierung entfernt sich von dieser Philosophie.
Nehmen wir beispielsweise das Verhältnis zu Ausländern. Heutzutage werden Hilfszentren für Ausländer geschlossen. Gestrichen werden auch finanzielle Zuschüsse für NGOs, die Hilfsleistungen für manche Bedürftige anbieten. So war es u.a. bei Frauenrechtsorganisationen, die sich um Opfer häuslicher Gewalt kümmerten.
Doch es geht hierbei nicht nur um konkrete Vorschriften, sondern auch um eine entsprechende Unterfütterung für dieses System. Die Strategie besteht darin, Gruppen auszugrenzen, die der Regierung auf irgendeine Weise unbequem sind. Das ist ein grundlegender Wandel in der Rechtsauffassung – eine Veränderung der Koordinaten.
Weitere Reformen stehen jedoch unter dem Schlagwort der Öffnung und der Annäherung an den Bürger. Nicht anders ist es mit der derzeit geplanten Reform des Landesrates für Gerichtswesen[2].
Beginnen wir bei den Grundlagen. Richter werden können in Polen zur Zeit nur Juristen mit einer Reihe von Voraussetzungen: Sie müssen u.a. mindestens 29 Jahre alt sein, ein Jurastudium sowie ein Richterreferendariat an der Juristischen und Staatsanwaltlichen Landesschule absolviert und eine Empfehlung des Landesrates für Gerichtswesen erhalten haben. Endgültig in sein Amt berufen wird ein Richter durch den Präsidenten. Auf welcher Grundlage trifft der KRS diese Wahl? Der Hauptvorwurf der PiS gegen das derzeitige System lautet, diese Wahlen seien auf eine bestimmte „Clique“ beschränkt.
Der Vorwurf, die Gerichte seien zu wenig demokratisch, wird seit Jahren erhoben. Das ist das Los der Richter.
Warum?
Einer berühmten Anekdote zufolge wickelte Stańczyk[3] sich eines Tages ein Tuch um den Kopf und ging auf den Krakauer Markt, wo er so tat, als litte er an Zahnschmerzen. Alle wollten ihn heilen, jeder riet ihm etwas anderes. Doch Medizin ist Wissen, und genauso ist es mit dem Recht, man muss es „mit Verstand zu lesen wissen“. Die Menschen können sich einbilden, das wäre leicht. Schließlich sagte schon Lenin, selbst eine Köchin könne ein Land regieren. Gemäß einer solchen Denkweise kann jeder Richter werden. Tatsächlich gibt es Systeme, bei denen in Gerichtsverfahren eine Geschworenenbank zu Wort kommt, auf der gewöhnliche Leute sitzen. Doch man muss bedenken, worüber eine solche Bank urteilt.
Über Schuld oder Unschuld.
Und den ganzen Rest erledigen der Richter und speziell ausgebildete Juristen. Volksvertreter werden also nur bei einem bestimmten Teil der Verhandlung hinzugezogen. Demokratisierung darf nicht darin bestehen, dass eine Person, die keine Ahnung vom Rechtssystem hat, über alle Arten von Fällen urteilen soll. Recht ist Wissen, es stimmt nicht immer mit einem dem „gesunden Menschenverstand“ entspringenden Gerechtigkeitsempfinden überein.
Kürzlich kam ein ausgezeichneter Film in die Kinos, „Verleugnung“. Darin geht es um einen Prozess des bekannten Holocaustleugners David Irving gegen eine amerikanische Historikerin jüdischer Herkunft, Deborah Lipstadt[4]. Er hatte sie wegen Verleumdung angeklagt, weil sie gesagt hatte, dass seine Leugnung des Holocaust und der Gaskammern auf einer Lüge basiere. Der Prozess wurde in England geführt, und die Amerikanerin konnte nicht begreifen, was im Gerichtssaal geschah. Die Juristen, die sie vertraten, versuchten um jeden Preis die Aussage echter Augenzeugen des Holocausts, die den Krieg überlebt hatten, zu verhindern.
Warum denn?
Weil sie aufgewühlt von den schrecklichen Dingen erzählt hätten, die sie erlebt haben, und sicher alles durcheinandergebracht hätten: Entfernungen, Tage, Daten, Menschen. Damit hätten sie die ganze Sache zu Fall gebracht. Zu einem gerechten Urteil kommt das Gericht ein wenig anders – infolge verschiedener Vorschriften – als der Durchschnittsbürger vielleicht denkt. Dieser Film zeigt die Zerrissenheit des Gerichts sehr gut: auf der einen Seite den Zwang einer vorschriftsmäßigen Beweisführung, und auf der anderen das moralische Dilemma, das oftmals damit einhergeht. Ob es uns nun gefällt oder nicht: Will man ein Urteil sprechen, muss man wissen, wie das geht.
Die Idee der Regierungspartei besteht darin, die Gesellschaft zu spalten. Eine kleinere, geschlossenere, ethnisch einheitliche Gruppe zu schaffen. Wirft man die »faulen Äpfel« weg, behält man nur die besten. Und der Rest? Soll sich anpassen.
Ewa Łętowska
Ich will damit nicht sagen, dass unsere Gerichte gut sind. Aber es ist nicht so, wie die populistische Propaganda sagt, dass man jeden X-Beliebigen als Richter einsetzen könnte und er dann seiner Pflicht hervorragend nachkäme.
Die PiS will aber nicht Richter aus dem gemeinen Volk auslosen, sondern behauptet, innerhalb der Richterschaft selbst sei die Wahl der Richter nicht sauber vonstatten gegangen.
Und wie will sie diesen Stand der Dinge ändern? Richterkandidaten sollen vom KRS vorgeschlagen werden, aber wer von den Richtern in den KRS kommt, das soll in der Praxis der Parlamentspräsident bestimmen. Die ganze neue Struktur des KRS soll dem Parteiestablishment den entscheidenden Einfluss auf die Justizpersonalien garantieren.
Die PiS-Politiker berufen sich auf ein besonderes Demokratieverständnis. Sie sagen, ein Abgeordneter hat ein gesellschaftliches Mandat – er ist schließlich gewählt worden.
Und deswegen kann er bessere Richter benennen? Die Abgeordneten wählen Richter nicht wegen ihres Wissens, sondern so, wie sie die Richter des Verfassungsgerichts wählen wollten: Sie stimmen für „ihre“ Leute.
Und wir sollten daran denken, dass in den KRS weiterhin Richter gewählt werden, also Vertreter der, wie Sie gesagt haben, „undemokratischen Kaste“. Meinen Sie, dass es bei unseren Verhältnissen eine gute Lösung ist, Politikern solche Macht zu geben, und dass Parlamentspräsident Kuchciński eine bessere Wahl trifft als die Richterkollegien? Im letzteren Falle ist es eine Gruppe, die wählt – das ist wohl demokratischer als die Wahl durch einen einzigen Parlamentspräsidenten. Noch dazu, wenn dieser einer Gruppierung angehört, die in Parlament und Senat absolut überwiegt.
Und damit nicht genug. Nach den Plänen der Regierung soll der KRS in zwei Kammern zerschlagen werden. Eine soll vom politischen Element dominiert werden, angehören werden ihr u.a. der Justizminister, vier Abgeordnete und zwei Senatoren. Der anderen sollen 15 von Politikern ernannte Richter angehören. Derzeit gibt es keine Trennung in Kammern; nach der Reform wird dann jedwede Entscheidung eine Einigung beider Kammern erfordern, die sich gegenseitig in Schach halten werden. Ist das etwa eine demokratische Lösung?
Das sagt jedenfalls die Regierung.
Wenn Sie wollen, kann ich diesen populistischen Argumenten etwas entgegensetzen. Das hat jedoch meiner Ansicht nach wenig Sinn, übernehmen wir doch dann die Narration, die uns politische Manipulanten aufzwingen wollen.
Wenn man den Gerichten als solchen ein demokratisches Defizit vorwirft, weil sie nicht in allgemeiner Wahl gewählt werden, dann stimme ich dem zu. Das ist ja das Schöne an den Gerichten. Warum also wollen wir dagegen vorgehen? Viel klüger wäre es, dafür zu sorgen, dass die Gerichte in merito besser werden. Doch ein Wahlsystem, wie es die Regierung vorschlägt, hilft da nicht. Das Problem der Justiz ist vor allem Können, Sensibilität und Mut, und dort müsste man mit der Verbesserung ansetzen.
Auf der Webseite des Justizministeriums kann man eine ganz Liste von Ländern finden, in denen Richter von Politikern ausgewählt werden: Österreich, Deutschland, Dänemark.
Das stimmt, aber diese Länder sind über Jahrzehnte zu dem Wahlsystem gelangt. Bei uns findet das System gerade erst seine Stabilität. Und kaum sind wir zu einem bestimmten Wahlsystem gelangt, verwerfen wir es unter dem Vorwand der Demokratisierung wieder. Hätten wir in Polen solche Politiker und politischen Standards wie in den drei von Ihnen genannten Ländern – dann würde ich mich nicht so beharrlich dagegen sperren.
Aber die Regierung behauptet…
Ich bitte Sie, dass die Regierung etwas sagt, ist für mich kein Argument. Diese Rhetorik dient genau dazu, dass Sie darauf eingehen. Das Schlagwort von der Demokratisierung der polnischen Gerichte ist griffig und zugleich irreführend. Kein Gericht ist jemals demokratisch. Das können und sollen Gerichte auch nicht sein. Sie sollen weise und gerecht sein. All das Gerede von der Demokratisierung lenkt die Diskussion in falsche Bahnen. Das ist ein Deckmantel, in den man diese Reform hüllt, um ihre wahre Ziele zu verbergen. Angewandte Schampädagogik[5].
Das heißt?
Die Spezialität des Demiurgen (dieses Demiurgen!) ist, die Führung zu übernehmen, indem er Konflikte entfacht[6]. So auch in diesem Fall. Man führt eine Kampagne durch, um die Autorität der Richter zu erschüttern: Man zieht Fälle heran – oft jahrealte –, in denen kontroverse Urteile ergangen sind, man bezichtigt einzelne Richter größerer und kleinerer Delikte. Dazu kommt dann die in Polen auch im Milieu der Richter weit verbreitete Haltung, um jeden Preis die eigenen Leute zu decken und nichts Schlechtes über sie zu sagen, selbst dann, wenn das Milieu Kritik verdient hat. Wenn dann eine ganze PR-Strategie auf diese schlechten Gepflogenheiten zugeschnitten wird, entsteht ein populistisch herangezüchteter Konflikt zwischen Gerichten und Öffentlichkeit.
Ein Gericht kann nicht gut funktionieren, wenn es sich selbst nicht achtet und keine Achtung hervorruft. Ein gutes Beispiel ist das Verfassungsgericht.[7] Ihm ist nicht mehr zu helfen, es ist seiner Würde beraubt, wurde es doch in eine Kneipenschlägerei unter fremder Flagge verwickelt. Dasselbe kann die anderen Gerichte betreffen.
Ein Gericht kann nicht gut funktionieren, wenn es sich selbst nicht achtet und keine Achtung hervorruft. Ein gutes Beispiel ist das Verfassungsgericht. Ihm ist nicht mehr zu helfen, es ist seiner Würde beraubt, wurde es doch in eine Kneipenschlägerei verwickelt.
Ewa Łętowska
Nicht ohne Grund war eine der ersten Entscheidungen nach den Parlamentswahlen die Übernahme der öffentlichen Medien[8]. Das ist ein Informationskanal, mit dem die Weltanschauung von Millionen Polen geformt werden soll. Heute tischt man in den öffentlichen Sendern den Menschen Geschichten auf, die das Vertrauen in die Gerichte erschüttern sollen, etwa Schicksale von Kindern, die ihren Eltern angeblich wegen deren Armut weggenommen wurden. Dabei gab es keinen einzigen der angeführten Fälle wirklich …
Bewegende Geschichten…
Aber sie sind unwahr. Solche Entscheidungen werden nicht wegen der Armut von Familien an sich getroffen, sondern wenn die Familie als solche versagt.
Wohin soll der Konflikt mit den Gerichten letzten Endes führen?
Sofern die Gerichte verfassungsgemäß eine der drei Gewalten darstellen – neben der Legislativen und der Exekutiven –, haben sie naturgemäß die Herrschaft über das Recht. Da nun Rechtsvorschriften nicht genau zu jeder Situation passen können, muss der Richter Rechte abwägen, nach einem Präzedenzfall suchen, überlegen, ob eine bestimmte Lösung zu der gegebenen Situation passt, usw. Diese Macht ergibt sich daraus, dass der Richter das Gesetz interpretiert. Das muss so sein, weil sich kein Rechtssystem herstellen lässt, das ohne Interpretation auskommt.
Betritt aber ein solcher Demiurg die Bühne und verkündet, dass der Staat nach seinem Willen geformt werden soll, so muss er die Macht der anderen Subjekte beschneiden, auch die der Richter.
Und was geschieht dann?
Die Gerichte, die sich schließlich auch nur aus Polen, Menschen aus Fleisch und Blut, zusammensetzen, schotten sich ab. Die Herde rückt zusammen, versucht entweder sich unsichtbar zu machen oder nicht im Wege zu stehen. Es kommt zu Einstellungen, die bei Richtern niemals entstehen sollten: Opportunismus und Vermeidungstaktik.
Professor Małgorzata Gersdorf, Präsidentin am Obersten Gerichtshof, hat zum Widerstand aufgerufen. „Um jeden Zoll Gerechtigkeit muss jetzt gekämpft werden, die Richter sind in der Pflicht. Kein Kampf ohne Opfer“, sagte sie auf einem Richterkongress[9].
Frau Gersdorf ist Juraprofessorin und Präsidentin des Obersten Gerichtshofes. Ich selbst rufe nicht zu solchen Haltungen auf, weil ich mit 77 Lebens- und nach 55 Arbeitsjahren solche Appelle nur zu leicht formulieren könnte. Ich kann mir das erlauben. Aber ein Provinzrichter mit Frau und Kindern, Krediten und Kleinstadtmilieu, wird mehr auf sein Umfeld achten.
Ich sage gar nicht, dass die Reform des KRS sofort negative Folgen zeitigen wird. Aber die Einstellung dieser Regierung zu den Gerichten – die sich auch in den Änderungsvorschlägen für den KRS zeigt – schon.
Bei dieser Veränderung geht es um die Beseitigung alter „Eliten“ und die Beförderung eigener. Das ist eine Neuauflage der „Janitscharenschule“, einer Einrichtung an Sultanshöfen, auf die junge Menschen aus dem ganze Reich geschickt wurden. Der Sultan sorgte für ihre Verpflegung und Ausbildung und kam so zu treu ergebenen Soldaten. Ich behaupte nicht, dass die PiS sich im Wortsinn treue Söldnerheere erschaffen will. Aber sie nutzt ein solches Modell. Einem ebensolchen Zweck dient ihre Bildungs- und Selbstverwaltungsreform.
Welche Folgen hat die Justizreform langfristig für das Staatswesen?
Verheerende.
Wenn das Personal ausgetauscht wird, kehrt das Vertrauen der Gesellschaft in die Gerichte so bald nicht zurück.
Ganz im Gegenteil. Was der Propagandaapparat im Kampf mit dem Justizsystem – u.a. dem Verfassungsgericht – den Menschen einflößt, bleibt. Gewalt hinterlässt Gewalt. Deswegen erheben einige Konservative zu Recht Geschrei.
Einige. Andere finden, in diesen revolutionären Zeiten sei kein Platz mehr für Konservatismus. Marek Cichocki sagte im Gespräch mit der „Kultura Liberalna“: „Wir sind in eine Lage geraten, in der keine Rede mehr davon sein kann, dass wir unsere Institutionen hegen und pflegen, begießen und beschneiden müssen – wofür sich unter normalen Bedingungen ein typischer Konservativer aussprechen würde.“
Hören Sie, mein PESEL beginnt mit einer „40“. Ich schaue mir das Ganze also interessiert an und sage: „Spannende Zeiten“. Aber wenn mein PESEL vorne eine „70“ oder „80“ hätte, dann würde ich mir Sorgen um mich und meine Kinder machen müssen.[10]
Inwiefern?
Wegen der fortschreitenden Demoralisierung.
Wenn so große gesellschaftliche Gruppen stigmatisiert werden, denn es geht ja nicht nur um die Gerichte, sondern auch um Kommunalverwaltungen, Polizisten …
… Militärs …
… NGO-Aktivisten, Geschäftsleute – wenn man alle Vertreter dieser Gruppen ausschließt und anklagt, schafft man eine große Armee Frustrierter und potenzieller Erzfeinde.
Und deswegen habe ich Angst. Ein Staat, der aus einem Apparat besteht, also aus dem Establishment, und der feindliche und abgeneigte Massen gegen sich hat, ist nicht nur ein Staat, in dem es sich schlecht leben lässt, weil er unangenehm ist und eine ungute Atmosphäre herrscht. Er ist auch ein gefährlicher Staat.
Der Apparat wird nämlich mit einer zunehmenden Ergebnislosigkeit seiner Bemühungen konfrontiert: Man macht und macht, aber die Ziele rücken in immer größere Ferne. Die Schuld am mangelnden Erfolg gibt man den „über alle Grenzen gehenden“ Protestlern – die in einer derartigen Situation irgendwie diszipliniert werden müssen. Die Punitivität des Rechts wird immer höher geschraubt. Das passiert bereits jetzt. Beispielsweise wurde jemandem der Prozess gemacht, nur weil er vor dem Sejm demonstriert und ein Transparent mit Kritik an der Regierungspartei in eine Fernsehkamera gehalten hatte.[11] Er wurde beschuldigt, die Arbeit jenes Fernsehjournalisten behindert zu haben, obwohl das Gegenteil der Fall ist: Er hat dessen Arbeit erst ermöglicht. Das ist keine Auslöschung des Rechtsstaats mehr, es ist die Auslöschung der Demokratie.
Es ist zudem pervers, denn es geschieht im Namen der „Medienfreiheit“, also eines Grundpfeilers der liberalen Demokratie.
Natürlich, das ist pervers. Es ist vollkommen klar, dass Freiheiten miteinander kollidieren. Und die Freiheit des einen endet dort, wo die Unfreiheit des anderen anfängt. Im Falle dieses Demonstranten besteht kein Zweifel, dass er die Freiheit der Medien nicht beschnitten hat.
Wohin führen diese ganzen Maßnahmen, wenn sie Erfolg haben?
Zum Autoritarismus.
Man will ja aus einem bestimmten Grund an die Macht …
Bitte fragen Sie mich nicht so etwas. Sie sind ja kein kleines Kind mehr. Man will an die Macht, weil die Macht süß ist.
Ich will der derzeitigen Regierung gar nicht die Sensibilität für die Gesellschaft absprechen, ja, ich bezweifle nicht einmal die Treffsicherheit ihrer Diagnosen. Doch bei der Behandlungsmethode muss ich ganz entschieden Widerspruch einlegen. Im Falle der Justizreform stimmt es nicht, dass die Gewaltenteilung Richterherrschaft bedeuten würde, und es stimmt nicht, dass die Richter eine geschlossene Kaste bilden würden. Und selbst wenn man meinte, es gebe bei ihnen derlei Tendenzen, dann würden sie durch die Mittel, die ihnen die Regierung verabreichen möchte, bestimmt nicht geheilt. Die Änderungsvorschläge führen weder zur „Demokratisierung“ noch – was am wichtigsten ist – zu einer verbesserten Funktionsweise der Gerichte. Aber damit befasst sich überhaupt niemand.
Was ist das vordringlichste Problem der polnischen Gerichte?
Die schlechte Ausbildung. Die Richter sind nicht professionell genug, um aus dem normativen Material, das sie haben, sachkundig eine Lösung herauszuschälen, die nicht nur gesetzeskonform und gerecht ist. Genauso wichtig wäre es, dass sie diese Lösung der Nation erklären könnten. Die Krise der Gerichte ist eine Kommunikationskrise!
Das Problem rührt daher, dass die Gerichte „unbetreut“ sind. Es gibt im Rechtssystem niemanden, der sich mit den Gerichten als Struktur befasst. Ganz sicher nicht der Justizminister, der heute eher ein Generalstaatsanwalt ist und als Parteiaktivist danach trachtet, seine politische Bedeutung zu festigen. Ganz sicher auch der Oberste Gerichtshof nicht, er ist sich nicht einmal so recht bewusst, dass er diese Rolle spielen könnte. Wer also sollte die Gerichte betreuen?
Kommen wir auf die Kommunikationskrise zurück. Die Gerichte wissen nicht, wie sie mit dem Bürger sprechen sollen.
Und sie verspüren kein Bedürfnis danach. Ein Richter verkündet seine Urteile unter dem Adler, in der Robe und im Namen der Republik. Diese Elemente des decorum sind alle notwendig, aber nicht hinreichend. Vielen Richtern scheint es, wenn sie in diesem Gepränge ein Urteil verlesen, als rechtfertige allein die Autorität der Republik ihre Begründung. Das stimmt nicht. Die Hörer des Urteils müssen in der Mitteilung des Gerichts zudem Sorgfalt und Aufmerksamkeit für ihre Probleme und Angelegenheiten erkennen. Fragen Sie mich nicht, worauf das beruht. Ich weiß, wie man das macht, kann es aber nicht erklären. Das muss einer ausstrahlen, man muss sehen können, dass er etwas erklären möchte. Aber das fehlt. Vielleicht ist das ein Fehler in der Richterausbildung.
Ich will der derzeitigen Regierung gar nicht die Sensibilität für die Gesellschaft absprechen, ja, ich bezweifle nicht einmal die Treffsicherheit ihrer Diagnosen. Doch bei der Behandlungsmethode muss ich ganz entschieden Widerspruch einlegen.
Ewa Łętowska
In Polen ist jeder ein „Bürger als Edelmann“, zumal wenn er eine irgendwie geartete Macht hat. Auch ein Richter hat Macht. Bis zum Überdruss wird wiederholt, dass das Richteramt ein Dienst sein soll, dass ein Richter sich – bei aller Würde seines Amtes – von Mitgefühl leiten lassen sollte. Davon wird immer gesprochen, aber Folgen sind keine zu sehen.
Diesen Vorwurf kann man auch vielen anderen Berufsgruppen machen: Ärzten, Hochschuldozenten, Unternehmern.
Stimmt. Wir sprachen von der Demokratisierung. Meiner Überzeugung nach besteht sie gerade darin. Wenn ein Arzt auf einen Patienten trifft, weiß er besser, was diesem fehlt. Aber er muss es ihm erklären wollen. Bei einem Juristen ist es ähnlich.
Der Gedanke, die Wahl der Judikativen durch demokratisch gewählte Politiker könne die Lösung für eine Demokratisierung der Judikativen sein, ist naiv und doktrinär. Man muss der Judikativen etwas beibringen, damit sie fach- und sachkundiger wird, und sie zu Verantwortung und Achtsamkeit erziehen, damit sie sich bürgerschaftlich engagiert. Keines dieser Ziele erreicht man durch eine Wahl der Richter aus dem Volk oder durch die Ernennung von Fachleuten durch Politiker. Das ist ein bisschen so wie bei einem Symphonieorchester. Man darf mangelndes Können um Gottes Willen nicht durch Demokratie zu ersetzen versuchen.
Ist das Gesetz, das der Justizminister vorschlägt, verfassungskonform?
Denken Sie an Möglichkeiten, hic et nunc vor dem Verfassungsgericht gegen dieses Gesetz zu klagen? Das hat wenig Sinn, ist doch dem Verfassungsgericht jetzt die Funktion einer Legitimierungsmaschine zugewiesen worden. Falls ich ungerecht bin oder mich irre, werde ich in zwei Jahren (denn so lange dauert es, bis man das sehen kann) mit aufrichtiger Freude meinen Irrtum zugeben. Aber vielleicht wollen Sie wissen, ob dieser Vorschlag, den Status des KRS zu verändern, meiner Einschätzung nach der Verfassung widerspricht?
Ja. In Absatz 4, Artikel 187 der Verfassung heißt es: „Die Ordnung, den Umfang der Tätigkeit und die Arbeitsweise des Landesrates für Gerichtswesen sowie die Wahl seiner Mitglieder regelt ein Gesetz.“ Bedeutet das, dass das Justizministerium die Verfassung in diesem Fall nicht bricht?
Meiner Einschätzung nach ist das nicht verfassungskonform. Ein Gesetz muss schließlich am Standard gründlicher Gesetzgebung gemessen werden (Art. 2 der Verfassung). Und Art. 187 Abs. 1, der davon spricht, dass 15 Richter aus der Mitte der Richterschaft in den KRS gewählt werden, war nicht so gedacht, dass die Wahl ersetzt wird durch die Ernennung durch einen einzigen Parlamentspräsidenten.
Aber wissen Sie, auch das hat es schon gegeben. Jahrelang stand in der Verfassung, dass die Richter des Obersten Gerichtshofes „durch Wahl bestimmt“ werden. In der Praxis wurden sie vom Staatsrat gewählt.[12] Gab es eine Wahl? Es gab sie. Wenn wir zu den Standards der Verfassung von 1952 zurückkehren, können wir auch dieses Gesetz als verfassungskonform betrachten. Ein Déjà-vu.
[1] Kritiker der PiS wie Ewa Łętowska werfen der Partei oftmals vor, die Menschen in ihrem Land in „wahre Polen“ (konservativ und katholisch eingestellte PiS-Wähler) und „falsche Polen“ (gegen die PiS-Politik eingestellte Bürger) einzuteilen. Die Formulierung „wahre Polen“ wird dabei dem Vorsitzenden der PiS, Jarosław Kaczyński, zugeschrieben – auch wenn dieser behauptet, sich niemals so ausgedrückt zu haben (vgl. „PiS: Kaczyński nie mówił o <<prawdziwych Polakach>>“ [PiS: Kaczyński hat nie von <<wahren Polen>> gesprochen] wiadomosci.wp.pl/pis-kaczynski-nie-mowil-o-prawdziwych-polakach-6036142134195329a), und auch andere Formulierungen aus seinem Mund wurden von Kritikern in diesem Sinne interpretiert.
In einer Sendung des rechten Fernsehsenders TV Republika hatte der Vorsitzende der Partei Prawo i Sprawiedliwość (Recht und Gerechtigkeit, PiS) die Meinung vertreten, dass diejenigen, welche die gegenwärtige Regierung in Warschau kritisierten, „Personen der schlimmsten Sorte“ seien, denen der Verrat in den Genen liege (Telewizja Republika – Jarosław Kaczyński (PiS) – W Punkt 2015-12-11, <www.youtube.com/watch?v=LCK_biZe_KU>, hier ab Minute 17).
[2] Landesrat für Gerichtswesen, KRS – kollegiales Verfassungsorgan Polens, bestehend seit 8. April 1989. Der Rat betrachtet und bewertet u.a. Kandidaturen für die Ausübung des Richteramts, er urteilt über die Ein- und Abberufung der Vorsitzenden und Vize-Vorsitzenden von ordentlichen und Militärgerichten etc. Der Reformplan für den KRS, den die PiS vorgelegt hat, beinhaltet v.a. ein geändertes Verfahren für die Wahl von Richtern in den KRS – von jetzt an sollen sie durch den Sejm berufen werden und nicht, wie bisher, von den Richtern selbst – <Projekt reformy KRS przygotowany przez PiS zakłada przede wszystkim zmianę sposobu wyboru sędziów do KRS – od tej chwili mieliby oni być powoływani przez Sejm, a nie, jak do tej pory, głównie sami sędziowie> – sowie eine Reform dieses Organs, infolge derer es von nun an aus zwei Kammern bestehen soll. Diskutiert wird über eine Reform des KRS bereits seit Jahren; derzeit wirft die Opposition der PiS-Regierung vor, kein verbessertes Wahlverfahren für die Richter oder eine größere Bürgernähe der Gerichte erreichen zu wollen, sondern vielmehr eine bessere Kontrolle über die Justiz anzustreben. Vgl. „Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o KRS“ [Regierung plant eine Erneuerung des KRS-Gesetzes] wiadomosci.onet.pl/kraj/rzad-przyjal-projekt-nowelizacji-ustawy-o-krs/bkw8el6 sowie: „Krajowa Rada Sądownictwa: władza kłamie o sędziach. 32 wypowiedzi, głównie Ziobry“ [Landesrat für Gerichtswesen: Die Lügen der Regierung über die Richter. 32 Äußerungen, v.a. von Zbigniew Ziobro], oko.press/krs-dokumentuje-falszerstwa-wladzy-przestancie-klamac-temat-sadow/.
[3] Anspielung auf Stańczyk, den legendären Hofnarren von Johann I., Alexander, Sigismund I. und Sigismund II., der im 15. und 16. Jh. lebte. Stańczyk war für seinen scharfen Witz bekannt, galt als vielseitig gebildet und großer Patriot. Die Figur des Stańczyk tritt in vielen Werken der polnischen Literatur auf. Er wurde auch porträtiert – das berühmteste Porträt stammt von Jan Matejko.
[4] „Verleugnung“, Regie Mick Jackson, USA/Großbritannien 2016.
[5] Ewa Łętowska spielt hier auf den Begriff der „Schampädagogik“ an, den rechte Publizisten in Polen verwenden. Nach deren Ansicht beruht die angebliche „Schampädagogik“ darauf, dass liberale und linke Milieus in Polen sich ausschließlich auf die „dunklen Flecken“ der polnischen Geschichte konzentrieren, indem u.a. Jan Tomasz Gross’ Thesen zu den polnisch-jüdischen Beziehungen forciert und Filme wie „Ida“ (eine junge Novizin entdeckt ihre jüdischen Wurzeln und begibt sich auf eine Reise, um ihre Entscheidung für das Ordensgelübde noch einmal zu überdenken; der Film wurde von manchen Kreisen als anti-polnisch und geschichtsfälschend kritisiert, da er eine Schuld Polens am Holocaust suggeriere (Anm. d. Übers.); Regie Paweł Pawlikowski, 2013) beworben würden. Vgl. z.B. Grzegorz Górny, „Polacy na ławie oskarżonych“ [Die Polen auf der Anklagebank], „W Sieci“, 27.04.–3.05.2015, S. 38-41. Die Schampädagogik hat ihnen zufolge zum Ziel, den Nationalcharakter der Polen negativ darzustellen, während vielmehr die heroischen Elemente der polnischen Geschichte hervorgehoben werden sollten.
[6] Ewa Łętowska hat hier Jarosław Kaczyński im Sinn, der, obwohl er derzeit in Polen kein offizielles Amt ausübt, als faktischer Anführer des in Polen regierenden Lagers gilt.
[7] Ewa Łętowska beruft sich hier auf den sog. Streit um das Verfassungsgericht, der in Polen von Ende 2015 bis Ende 2016 andauerte, als Julia Przyłębska neue Präsidentin des Verfassungsgerichts wurde. Zur Analyse dieses Streites siehe: Marta Bucholc, Maciej Komornik, „Die PiS und das Recht. Verfassungskrise und polnische Rechtskultur“, „Osteuropa“, 1-2/2016, Onlinezugriff: www.zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2016/1-2/die-pis-und-das-recht/.
[8] Die PiS hat nach den Wahlen 2015 viele leitende Posten in den öffentlichen Medien neu besetzt. Chef des Polnischen Fernsehens TVP wurde Jacek Kurski, früher Politiker der Partei Recht und Gerechtigkeit, heute der Solidarna Polska.
[9] „Prezes Sądu Najwyższego wzywa sędziów do oporu. Dramatyczne wystąpienie Małgorzaty Gersdorf“ [Präsidentin des Obersten Gerichtshofes ruft Richter zum Widerstand auf. Dramatischer Auftritt von M.G.], wyborcza.pl/7,75398,21315772,prezes-sadu-najwyzszego-wzywa-sedziow-do-oporu-dramatyczne.html?disableRedirects=true.
[10] PESEL heißt die Registrierungsnummer natürlicher Personen im polnischen Allgemeinen Elektronischen Bevölkerungserfassungssystem (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Die PESEL-Nummer ist das grundlegende Identifikationsmerkmal der Bürger Polens. Sie beginnt jeweils mit dem Geburtsjahr. Spricht also Ewa Łętowska von der Zahl 40, ist das Jahr 1940 gemeint.
[11] Gemeint sind die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen zwei der Personen, die in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember vor dem Sejm gegen das Vorgehen von PiS-Politikern im Parlament protestierten, u.a. gegen Pläne, den Zugang der Medien zum Sejm zu beschränken, gegen den Ausschluss des Abgeordneten der Bürgerplattform, Michał Szczerba, sowie gegen die Verlegung von Abstimmungen, u.a. über den Haushalt für 2017, in den Säulensaal.
[12] Die Rede ist von den Vorschriften und der Praxis unter der Verfassung der Volksrepublik Polen, die nach dem Vorbild der stalinistischen Verfassung von 1936 aufgesetzt wurde und ab 1952 im kommunistischen Polen in Kraft war.
Fot. Ajel [CC 0]. Źródło: Pixabay.
Übersetzt von Lisa Palmes.